|
Zeit |
Wichtige
historische Ereignisse |
Entwicklung
des Bergbaus |
| 929 |
Der
sächsische Herzog Heinrich I. siegt in der Schlacht bei Oschatz über
die Slawen und gründet die Markgrafschaft und die Burg Meißen. |
|
| 968 |
Gründung
des Bistums Meißen. |
|
| 1089 |
Heinrich
von Eilenburg wird als erster aus dem Hause Wettin Markgraf zu
Meißen. |
|
| 1123 |
Konrad
der Große erhält die Markgrafschaft Meißen als erbliches Lehen
bestätigt. Auf dieser Grundlage forciert er die deutsche Besiedlung,
läßt Wälder roden und holt Bauern, Mönche und adlige Familien in
die noch dünn besiedelte und kaum genutzte Markgrafschaft. Er ist der
erste dargestellte Fürst auf dem weltberühmten Bild des
"Fürstenzuges" in Dresden. In dieser Zeit werden auch die
Burgen Reinsberg, Bieberstein, Rotschönberg und Heynitz als
Herrschaftssitze gegründet. |
Auffällige
Ortsnamen und Doppelorte, wie "Deutschenbora" und "Wendischbora"
zeugen noch heute von der Besiedlung durch Slawen
("Wenden") in unserer Region in dieser Zeit. |
| 1165 |
Gründung
des Zisterzienserklosters Altzella und der Burg in Nossen. |
|
| um
1168 |
Entdeckung
der Silbererze in Christiansdorf, dem heutigen Freiberg. Im Interesse
hohen Ertrags bei geringen Kosten für das Fürstenhaus liberalisiert
der Sohn Konrads, Herzog Otto I., das feudale Bergbaurecht. Aufgrund
der hohen Ausbeute der Silberbergwerke in Freiberg und den wenig
jüngeren Bergstädten Bleiberg (bei Frankenberg) und Ullrichsberg
(bei Wolkenburg) erhält Otto I. den Beinamen "der Reiche". |
|
| 1307 |
älteste
erhaltene Niederschrift des Freiberger Bergrechts (Kodex A), eine
weitere entstammt dem Jahr 1346 (Kodex B). Aufgrund der
"Bergbaufreiheit" im früheren Christiansdorf hat sich für
die Bergstadt der Name "Freiberg" durchgesetzt. |
|
| 1356 |
Der
König von Böhmen und deutsche Kaiser Karl IV. verleiht dem Herzogtum
Sachsen-Wittenberg, als
wirtschaftlich mächtig gewordenem, nördlichen Nachbarn die
Kurwürde. |
In
diese erste Blütezeit des Bergbaus und zahlreicher Gründungen von
Burgen und Städten dürfte auch die erste Nutzung der Miltitzer
Kalkstein-Vorkommen fallen. Der genaue Zeitpunkt der Entdeckung ist
nicht überliefert - man vermutet die Zeit um 1400. |
| um
1400 |
Der
Bergbau stößt überall auf die Grenzen der mittelalterlichen
Technik: Die Bergwerke sind in große Tiefe vorgedrungen, aus der das
Grundwasser mühsam gehoben werden muß. Zugleich lassen die
Silbergehalte der Erze nach. So kommt es zu einem ersten Niedergang
des Bergbaus und eine Reihe von alten Bergstädten (Bleiberg,
Ullrichsberg) wird um 1390 aufgegeben und von ihren Bewohnern
verlassen. |
|
| ab
1450 |
Neue
Erzvorkommen werden im obererzgebirgischen Kreis entdeckt: Zuerst die
Zinnerze von Geyer und Altenberg, um 1470 die Silbererze in
Schneeberg, um 1496 in Annaberg, 1519 in Marienberg. Zugleich sucht
das in den Familien reicher Handelshäuser (z.B. der Fugger aus
Augsburg) angesammelte Kapital nach gewinnbringenden
Anlagemöglichkeiten. Diese Voraussetzungen führten zu einem neuen
Aufschwung der wirtschaftlichen Entwicklung. |
|
| 1485 |
Die
Brüder Ernst und Albrecht von Sachsen teilen ihr Erbe untereinander
auf (Leipziger Teilung). Ernst erhält Sachsen-Wittenberg und bleibt
Kurfürst, Albrecht behält die Markgrafschaft Meißen und die
Herzogswürde. |
|
| 1514 |
|
Auch
im Triebischtal werden neue Erzlagerstätten entdeckt. Zwischen 1514
und 1517 wird der Abbau von Silber-, Blei- und Kupfererz im
"Alten Wildemann- Erbstolln" bei Munzig
aufgenommen. |
| 1525 |
Die
protestantisch-lutherische Reformation führt das erste Mal zu kriegerischen
Auseinandersetzungen:
Vor allem in Thüringen toben die
Bauernkriege und werden blutig niedergeschlagen. |
|
| 1547 |
Im
Ergebnis des Schmalkaldischen Krieges wird die Kurwürde auf die
albertinische Linie des wettinischen Fürstenhauses übertragen.
Herzog Moritz ist der erste Kurfürst im heutigen Sachsen. Zugleich
übernimmt Sachsen die evangelisch-lutherische Religion. |
|
| 1571 |
|
Aus
diesem Jahr liegen die ältesten schriftlichen Überlieferungen über
das Kalkbergwerk Miltitz in den Akten des Finanzarchives Dresden vor. Zu dieser Zeit bestand vermutlich ein
bedarfsweise periodisch betriebener Tagebau im Bereich des späteren
"Blauen Bruchs" auf dem Graukalklager. Im Gegensatz zum
Erzbergbau, der dem landesherrlichen Regalrecht unterlag, war die
Gewinnung von Werkstein, Kalk, Kohle und z.T. auch Eisenerz
grundeigen. Wohl schon zu dieser Zeit befand sich das Alte
Kalkbergwerk Miltitz im Besitz der Familie von Heynitz. |
| |

|
| 1618 |
Die
päpstlich-katholische Gegenreformation und die andauernden
Auseinandersetzungen um Religion und Macht in Europa gipfeln im
Dreißigjährigen Krieg. Im Zentrum des Römisch-Deutschen
Kaiserreiches gelegen - zu dem damals ja auch Böhmen und
Österreich-Ungarn gehörten - wird Sachsen zum Kriegsschauplatz. Die
kaiserlichen Heere Wallensteins und die protestantischen Armeen unter
König Gustav-Adolf von Schweden durchziehen das Land, belagern,
plündern und verwüsten Städte und Dörfer. |
|
| 1648 |
Der
Westfälische Friede beendet den Dreißigjährigen Krieg. |
|
| 1694 |
Herzog
Friedrich August I. - genannt "der Starke" - wird
sächsischer Kurfürst. 1697 nimmt er den katholischen Glauben wieder
an, um dadurch König von Polen werden zu können. Er wird besonders
durch den Umbau Dresdens zur Residenzstadt im Stil des Barock
berühmt. |
|
1733
bis 1763 |
Sachsen
wird in die beiden Schlesischen Kriege verwickelt und unterliegt
schließlich im Siebenjährigen Krieg den Preußen. Erneut liegt die
Wirtschaft Sachsens am Boden. |
|
| ab
1763 |
Die
Zeit der Aufklärung beeinflußt auch die Kurfürsten Friedrich
Christian und Friedrich August III. Die Nachfolger Augusts des Starken
bemühen sich um einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung. |
Um
1750 wird in Miltitz das Weißkalklager entdeckt und zunächst
ebenfalls im Tagebau abgebaut. |
| 1765 |
Einen
Ausdruck findet Ihr Bemühen um die Erneuerung des Landes in der
Gründung der Bergakademie Freiberg. Hier werden die Fachleute
ausgebildet, die dem sächsische Bergwesen zu neuer Blüte verhelfen
sollen. Zu den ersten Studenten der Bergakademie gehörten u.a. A.von
Humboldt und Lomonossow. |
Die
in der Region ansässige Familie von Heynitz stellt in dieser Zeit mit
Anton von Heynitz (*1715, +1802) einen sächsischen
Generalbergkommissar. |
| um
1800 |
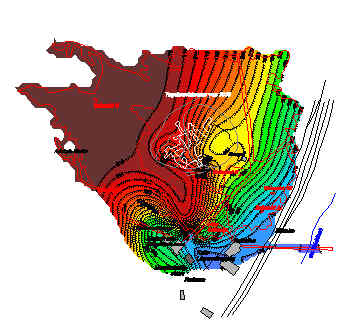
|
Um
1800 geht man im Weißkalklager vom Abbau im Tagebau zum untertägigen
Tiefbau über.
Karte der Lage des Alten
Kalkbergwerkes: Oberflächenrelief über den Tiefbauen, weiße
Konturen: Abbau im "Blauen Bruch" vor 1916
|
| 1806 |
Napoleon
Bonaparte überzieht ganz Europa mit Kriegen und ordnet Ländergrenzen
neu. Seine Armee besetzt auch Sachsen, das er zum Königreich erhebt .
Aber auch die Grundsätze der Französischen Revolution - Libertè,
Egalitè, Fraternité - verbreiten sich durch Europa. |
|
| 1813 |
In
der Völkerschlacht bei Leipzig wird Napoleon von den alliierten
Truppen vernichtend geschlagen. Sachsen tritt erst im Laufe der
Schlacht auf die Seite der Verbündeten über. |
Zwischen
1812 und 1819 überschreitet der Tiefbau im Alten Kalkbergwerk bereits die 1.
und 2. Sohle und erreicht damit eine Tiefe, die die Grundwasserhebung
erforderlich macht. In dieser Zeit wird die Rösche angelegt. |
| 1831 |
Das
Königreich Sachsen erhält eine Verfassung. |
|
| 1833 |
Beginn
der Geologischen Landesuntersuchung durch die Bergbehörden und die
Bergakademie Freiberg. Damit werden die natürlichen Ressourcen eines
Landes erstmals in der Welt systematisch untersucht. Zugleich sollen
neu entdeckte Lagerstätten den Wirtschaftsaufschwung fördern. |
|
| 1834 |
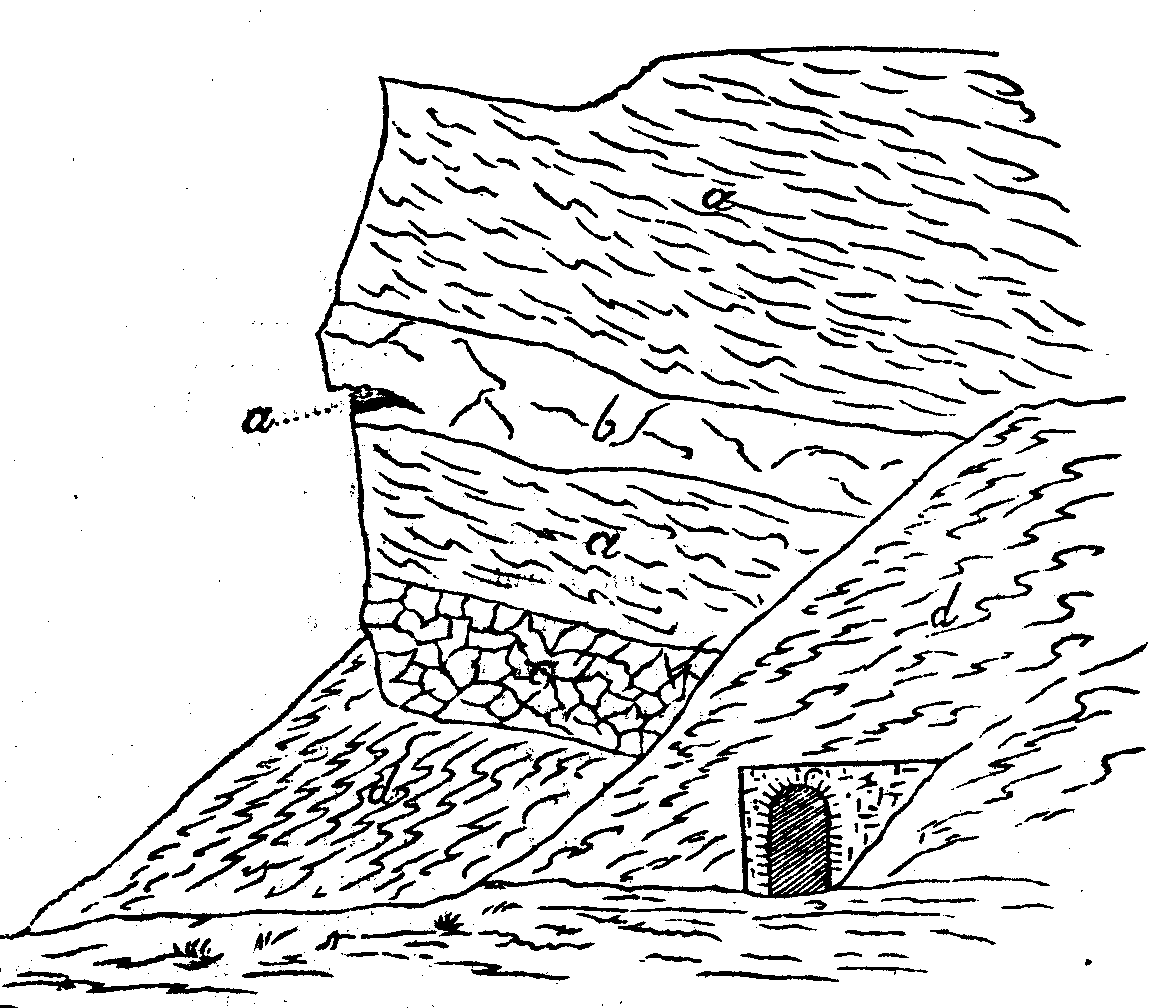
|
1834
beschreibt Bernhard von Cotta in
einem Brief an den Geheimrath Dr. von Leonhard erstmals geologische
Details der Miltitzer Kalklagerstätte.
Er schreibt u.a., daß bereits 1819 "eine Höhle von 100
Schritt Länge und 12 Schritt Breite" entstanden sei, die "bei
Fackelschein befahren, einen großartigen Eindruck hervorbringt
!" |
| 1837 |
Entdeckung
und Abbaubeginn der Braunkohlenvorkommen von Bitterfeld, wenig später
Entdeckung der Steinkohle in Lugau-Oelsnitz. Damit erhält Sachsen
eine eigene energetische Basis. 1839 fährt die erste deutsche
Fernbahn von Leipzig nach Dresden, 1848 wird auf der Alten Elisabeth
Fundgrube in Freiberg eine erste Dampfmaschine für den Antrieb der
Fördertechnik in Betrieb genommen. |
|
| |

|
| 1844 |
|
Baubeginn
des Tiefen Rothschönberger Stollns, der ausgehend vom Triebischtal,
dem Freiberger Bergbaurevier technische Erleichterungen und
Grundwasserableitung verschaffen soll. |
| 1851 |
|
Im
Rahmen der geologischen Landesuntersuchung widmen sich Arbeiten des
Geologen W.Vogelsang erstmals der Beschreibung der Kalkstein- und
Erzvorkommen in Munzig. Weitere Untersuchungen widmen sich 1862 den
Brauneisenstein-Vorkommen von Schmiedewalde und Burkhardtsdorf, die
zwischen 1833 und 1870 in Abbau standen. |
| nach
1860 |
|
Adolph
von Heynitz beantragt Abbaurechte auf einem kleinen Erztrum in Miltitz
und läßt einen Stolln anlegen. Die Silbererzfunde sind jedoch
minimal und ein Weiterbetrieb unwirtschaftlich, so daß er um 1886
aufgegeben wird.
Auch
die Fertigstellung des Rothschönberger Stollns im Jahr 1877 kann am
erneuten Niedergang des Erzbergbaus in Sachsen nichts mehr
ändern. |
| 20.12.1868 |
Die
Kgl. Sächsische Eisenbahngesellschaft errichtet die Borsdorf-
Meißner Eisenbahnstrecke. Damit erhält das Alte Kalkbergwerk in
Miltitz zwar einen günstigen Transportanschluß, muß jedoch
andererseits auf gewinnbare Kalksteinvorräte, die unter der späteren
Bahnlinie liegen, verzichten. |
Auch
in Miltitz erfolgt die Förderung aus den Tiefbauen jetzt mittels
einer Dampfmaschine. Der neue Tagesschacht (der
"Förderbremsberg") und der Abbau im Weißkalklager hat
bereits die tiefsten Sohlen erreicht und auch im Graukalklager des
"Blauen Bruchs" ist man zum Abbau untertage übergegangen.
Neben dem alten Niederschachtofen hat man einen hohen Schachtofen zum Brennen des Kalkes errichtet. |
| 1869 |
Das
1.Sächsische Berggesetz tritt in Kraft. Damit werden einerseits die
kurfürstlichen Bergämter aufgehoben und den Bergwerksbesitzern wird
wirtschaftliche Selbständigkeit verschafft. Andererseits fallen nun
auch die bisher grundeigenen Rohstoffe - also auch das Kalkbergwerk
Miltitz - unter die Aufsicht und technische Kontrolle durch das
Landesbergamt. |
Etwa
seit 1899 sind Unterlagen über das Kalkbergwerk Miltitz im Bergarchiv
Freiberg nahezu vollständig erhalten.
Ältere Akten könnten noch aus dem früheren Bergamt Altenberg
stammen, dem in dieser Zeit zuerst die Bergaufsicht übertragen war.
Sie sind jedoch leider sehr schlecht erhalten und nicht mehr
einsehbar. |
| 1871 |
Das
deutsche Kaiserreich wird gegründet. Unter Vorherrschaft Preußens
geht das Deutsche Reich zur Goldmark als Währungseinheit über. Die
Silberbergwerke Sachsens werden dadurch unrentabel. |
|
| |
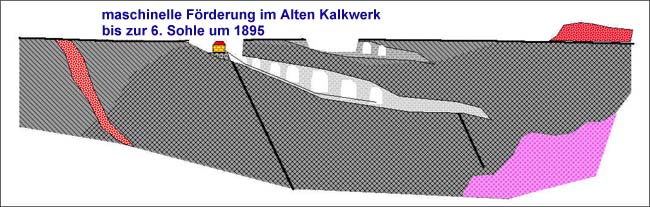
|
| 1913 |
Einstellung
des Erzabbaus im Freiberger Revier. |
|
| 1914 |
Beginn
des 1. Weltkrieges. |
Aufgrund
der Mobilmachung muß in Miltitz ebenfalls der Abbau eingestellt
werden. Zum Ausgleich werden ab 1915 Kriegsgefangene - vor allem
aus Rußland - beschäftigt. Der untertägige Abbau hat inzwischen die
unterste Sohle erreicht, jedoch zeigt sich, daß das Kalklager hier
auskeilt und die Vorräte zu Ende gehen. |
| 25.
Mai 1916 |
|
Im
Alten Kalkbergwerk ereignet sich früh morgens um 7.45 Uhr ein schwerer Tagebruch. Dabei kommen
mehrere Arbeiter ums Leben. In den Akten genannt sind die Namen der
russischen Kriegsgefangenen Bolkow, Saitzkow, Rewa und Ryshenkow,
sowie des deutschen Häuers Bartsch. Der Abbau im Blauen Bruch muß in der Folge
gänzlich aufgegeben werden und große Teile des Bergwerkes werden
verschüttet. |
| |

|
| 1918 |
Ende
des ersten Weltkrieges. |
|
| 1919 |
Novemberrevolution
in Deutschland. Sie führt zur Gründung der Weimarer Republik und in
Sachsen zur Abdankung und zum Verzicht des letzten Wettiners auf den
sächsischen Thron. Damit endet die längste ununterbrochene
Fürstendynastie Europas ! |
Die
Familie von Heynitz einigt sich mit der Kgl. Sächsischen
Bahngesellschaft darüber, daß das Bergwerk nicht wieder
aufgewältigt wird und die Verfüllung der Hohlräume in der Nähe des
Bahngleises nicht fortgesetzt wird. Seitdem ruht der Abbau in Miltitz. |
| 1922 |
|
Der
Ingenieur M. Schneider beantragt auf dem Alten Kalkbergwerk
benachbarten Grundstücken Abbaurechte, tritt diese jedoch wenig
später an das Kalkbergwerk ab. |
| 1923 |

|
Der
Landvermesser Georg Schwarzbach beantragt 1923 im Auftrag der
Eisenwerke Lauchhammer einen Versuchsabbau von cirka 50 t Kalk zur
Gewinnung von Analysenmaterial und Zuschlagstoffen für die
Eisenhütte.
Der Plan wird vom Bergamt genehmigt, jedoch in Ermangelung
bauwürdiger Vorräte nach dem Sümpfen des inzwischen bis zur
Röschensohle abgesoffenen Bergwerkes wieder aufgegeben. Damit endet
der Abbau im Alten Kalkbergwerk Miltitz und im Oktober 1924 findet
sich in einem der letzten Befahrungsberichte des Bergamtes der Satz,
daß "das vollständige Absaufen der Grube
nur noch eine Frage von Wochen wäre."
Grundriß und
Sohlenrelief der Tiefbaue des Alten Kalkbergwerkes: Weiße Fläche:
Pinge des Tagebruchs von 1916.
|
1922
bis 1923 |
|
Der
Kaufmann Karl Jurisch erhält aufgrund der Erkundungsergebnisse im
"Wiesenstolln" und aufgrund des Erfolgs von 10 Suchbohrungen
ebenfalls 1923 Abbaurechte auf einem nun als "Neues
Lager" bezeichneten, zweiten Vorkommen etwa 400 Meter östlich
vom Alten Kalkbergwerk in Miltitz. Technisch geschickt soll es mit einem 235 Meter langen, flach
geneigtem Schrägschacht (dem "Tagesfallort") erschlossen
werden, von dem aus eine Seilbahn den gebrochenen Kalk in gerader
Linie weiter zu den Verarbeitungsanlagen des Alten Kalkbergwerkes und
zum Verladebahnhof Miltitz-Roitzschen befördert. |
| |
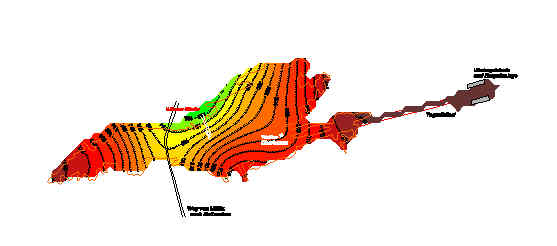
|
Karte des Oberflächenreliefs über dem
Neuen Kalkbergwerk Miltitz nach Grubenrissen von 1964. |
| 1925 |
|
Trotz
Grundwasserzuflüssen und zwei schweren Einbrüchen während des Baus
erreicht das Tagesfallort im September 1925 das Neue Kalklager und der
Kalksteinabbau wird begonnen. Zu dieser Zeit wurde noch der
Sprengstoff im Adolphstolln im Bereich des Alten Kalkbergwerkes
gelagert. |
| 1927 |
|
Noch
immer hat sich der Lehnsgerichtshof Dresden nicht über die
Rechtmäßigkeit des Verkaufs von Abbaurechten von der Familie von
Heynitz an Karl Jurisch entschieden. Daher steht noch immer die
Grundbucheintragung aus und Bankkredite werden nicht gewährt. |
| 1928 |
|
Karl
Jurisch muß den Abbau im Neuen Lager aufgeben, denn nachdem seine
finanziellen Mittel aufgebraucht sind und Rechnungen nicht mehr
bezahlt werden konnten, wurde zuerst der Strom abgestellt, später die
Maschinen gepfändet. 1930 erfolgt die Zwangsversteigerung. |
| 1933 |
Machtergreifung
der Nationalsozialisten. |
|
1936
und 1937 |
Untersuchungen
der Lagerstättenforschungstelle über die Bauwürdigkeit von
Kalksteinvorkommen in Sachsen. Die chemischen Analysen verschiedener
Kalksteine zeigten jedoch, daß das Material aus Miltitz
außerordentlich rein und "für die
Herstellung von Portlandzement völlig ungeeignet"
war. |
|
| 1939 |
Beginn
des Zweiten Weltkriegs |
|
| 1944 |
Die
alliierten Luftangriffe haben besonders die Wirtschaftsstandorte
Deutschlands zum Ziel, um den Nachschub an militärischem Material zu
unterbrechen. Die sowjetische Armee stößt während der
Sommeroffensive 1944 weit nach Westen vor. |
|
| ab
Oktober 1944 |
|
Die
Organisation Todt versucht nach mehreren Mißerfolgen nun auch in
Miltitz eine Fabrik für Flugzeugbenzin untertage zu errichten und sie so vor
den Bombardements der Alliierten zu schützen. Dazu werden drei neue
Schächte angelegt und Teile der 1. und 2. Sohle des Alten
Kalkbergwerkes aufgewältigt. Die nötigen technischen Anlagen werden
am bisherigen Standort in Auschwitz-Monowitz demontiert und nach
Miltitz gebracht. Über 100 Gefangene, vor allem deutsche und
polnische "jüdische Mischlinge", Männer, Frauen und
Kinder, werden dazu in das "Arbeitserziehungslager III" nach
Miltitz gebracht und müssen unter unmenschlichen Bedingungen die
Arbeiten ausführen. Die Kinder Olga und Wladimir Koslenko und Anna
Bennowski gehören zu den ersten Opfern der katastrophalen
Lebensbedingungen. |
| März
1945 |
Die
Rote Armee steht bereits vor den Toren Berlins. |
Vier
Häftlinge versuchen, den Qualen zu entfliehen und werden "auf
der Flucht erschossen". Bekannt sind uns die Namen J.Stych,
A.Zialinski, St.Galant und V.Spalony. |
| 6.Mai
1945 |
Einmarsch
der Roten Armee. |
Insgesamt
17 Häftlinge haben während der Arbeit an der unterirdischen
Benzinfabrik den Tod gefunden. Bis zum Ende des Krieges wurde die
Fabrik trotzdem nicht fertiggestellt. |
| 8.Mai
1945 |
Mit
der bedingungslosen Kapitulation endet der Zweite Weltkrieg. |
Der
Oberingenieur Karl Behr aus Miltitz und der Maschinenbaumeister H.
Hellwig aus Radebeul gründen die "Kalkwerk Miltitz GmbH" neu
und nehmen bereits 1946 den Abbau von Kalkstein im Neuen Lager wieder
auf. |
| 1949 |
Gründung
der DDR. |
|
| 8.September
1951 |
|
Die
am Rande des Friedhofs anonym verscharrten Opfer des Naziregimes
werden in den Kastanienhain am Friedhof Miltitz umgebettet und ein
Ehrenmal eingeweiht. |
| 1951 |
Zahlreiche
bisher noch private Betriebe werden - durch Überzeugung oder Zwang -
verstaatlicht. |
Auch
die Kalkwerk Miltitz GmbH wird verstaatlicht und dem VEB (K)
Ziegelwerke Meißen zugeteilt.
Gleichzeitig beginnt die Bergsicherung Dresden mit Verwahrungs- und
Sicherungsarbeiten im Alten Kalkbergwerk. Mit der vollständigen
Verfüllung des Ostfeldes soll dauerhaft verhindert werden, daß im
Bereich der Bahnlinie Tagesbrüche eintreten. |
| 1953 |
|
Am
24.7.1953 fragte die Betriebsleitung beim Oberbergamt an, wie man sich
verhalten solle, denn "in letzter Zeit
mehren sich die Fälle, daß Schülergruppen mit ihren Lehrern das
Bergwerk besichtigen wollen". Das Bergamt Freiberg stellte
zwar Bedingungen hinsichtlich der Sicherheit, ließ aber damit auch
die ersten öffentlichen Besucherbefahrungen im Alten Kalkbergwerk
zu. |
| 1955 |
|
Ausgehend
von der durch Jurisch aufgeschlossenen und abgebauten 1. und 2. Sohle
wurden bis 1957 fast 100.000 Tonnen Kalkstein aus dem Neuen Lager
abgebaut. Der Abbau umfaßt nun auch hier bereits mehrere
Tiefbausohlen.
Die Prognose des Dipl.-Geologen W.Gotte (Berlin) fiel jedoch auch für
das Neue Lager ernüchternd aus: Die Vorräte seien nun weitgehend
erschöpft. Daher beschloß der Kreistag Meißen auf seiner 32.
Sitzung mit Beschluß Nr. 144 im Jahre 1955, das Bergwerk nunmehr
stillzulegen und nur die Verwahrung im Alten Kalkbergwerk noch zu Ende
zu führen. |
| 1957 |
|
Noch
einmal wird die Wiederaufnahme des Bergbaus - jetzt vom VEB (K) Stahl-
und Walzwerk Riesa - beim Bergamt Freiberg beantragt. Tatsächlich
wird der Abbau im Neuen Lager noch einmal aufgenommen. |
| 1964 |
|
Vielleicht
konnte sich das Stahlwerk eine Zeitlang selbst mit hochwertigen
Zuschlagstoffen versorgen, die allgemeinen Versorgungsprobleme in der
DDR jedoch lösten sich nicht. Mehrfach wurde fast die gesamte
Belegschaft des Bergwerkes an andere Stellen abgezogen, an denen im
Kombinat gerade dringend Arbeitskräfte benötigt wurden. Im Jahr 1964
mußte das Bergwerk erstmals gestundet werden. 1965 wurde der
vorgelegte Betriebsplan durch das Bergamt Freiberg nicht mehr
genehmigt. |
| |

|
Grundriß und Sohlenrelief der Tiefbaue
des Neuen Kalkwerks in Militz auf dem Stand um 1966, gut erkennbar ist
die systematische, rechtwinklige Anordnung der Pfeiler |
| 1966 |
|
Endgültige
Einstellung
des Abbaus. In den Folgejahren wird nur die Verwahrung im Alten
Kalkbergwerk beendet und auch das Tagesfallort und das
Wetterüberhauen im Neuen Kalkwerk werden verfüllt. Der alte
Wiesenstolln wird noch von der Wasserwirtschaft weiter genutzt. |
| 1975 |
|
Schließung
der Verwahrungsakte über das Alte Kalkbergwerk Miltitz. Zwar sind die
Zugänge nun "offiziell" verschlossen, doch für
Betriebsfeiern erinnerte man sich in der Bergsicherung Dresden noch
oft an die großen Räume im Alten Kalkbergwerk... Dadurch blieb die
Erinnerung an das Bergwerk erhalten. |
| 1990 |
Wiedervereinigung
Deutschlands. |
|
| 1996 |
Entsprechend
des Einigungsvertrages läuft 1996 auch die frühere
"Hohlraum-Verordnung" der DDR aus. Damit fallen Bergwerke
ohne Rechtsnachfolge ("Altbergbau") an den Grundeigentümer
zurück. |
Die
Gemeinde Miltitz - später im Gemeindeverband Triebischtal - hat aus
dieser "Not" eine "Tugend" gemacht: Nach der
Sicherung des Besucherweges und der Entwicklung eines
Führungskonzeptes konnte nicht nur ein Besucherbergwerk, sondern auch
ein Veranstaltungsraum mit ganz besonderem Flair entstehen, der in
dieser Art nahezu einzigartig ist: Das Besucherbergwerk "Altes
Kalkbergwerk Miltitz samt Adolph von Heynitz-Stolln" mit der
Pulverkammer und dem Konzertsaal untertage. |
| |
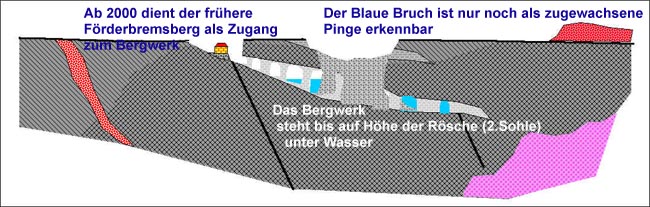
|
| 2000 |
|
600
Jahre nach dem Bergbaubeginn in
Miltitz
wurde das Alte Kalkbergwerk als Besucherbergwerk wiedereröffnet. |
| |
|
Neben
den zahlreichen Besuchern und den Veranstaltungsgästen schätzen
heute  Höhlentaucher das
Besucherbergwerk in den Wintermonaten als interessantes Übungsgebiet.
Auch hat sich eine Population der Kleinen Hufeisennase - eine der
kleinsten Fledermausarten - bei uns wohnlich eingerichtet. Höhlentaucher das
Besucherbergwerk in den Wintermonaten als interessantes Übungsgebiet.
Auch hat sich eine Population der Kleinen Hufeisennase - eine der
kleinsten Fledermausarten - bei uns wohnlich eingerichtet. |
![]()
![]() unsere E-mail-Adresse: anfrage@kalkbergwerk.de
unsere E-mail-Adresse: anfrage@kalkbergwerk.de
![]()